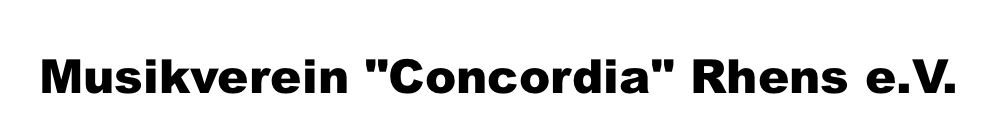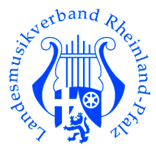| Keine Instrumentengruppe verkörpert den weltweit anerkannten Begriff der „deutschen Gemütlichkeit“ besser wie die Bügelhörner – Tenorhorn, Bariton, Euphonium und Tuba –, das mittlere bis tiefe Blech. In der Schublade dieses Klischees lassen sich auch Lederhosen, Knödel, Sauerkraut, Schweinshaxen und Maßkrüge finden. Dabei sind die Bügelhörner der mittleren bis tiefen Stimmlage bestimmt keine Instrumente ausschließlich für gesetzte Männer des fortgeschrittenen Alters.
Doch was zeichnet nun die Bügelhörner aus? Im Vergleich zur Trompete oder Posaune sind sie Blechblasinstrumente mit einer erweiterten Mensur (Rohrdurchmesser). Je weiter diese Mensur nun ist, desto weicher erklingen die Töne. Insbesondere die tiefen Töne erhalten mehr Volumen, allerdings auf Kosten der Brillanz in den hohen Stimmlagen. Sind also Tenorhorn, Bariton, Euphonium von ihrer Stimmlage fast identisch – sie liegen im Grundton eine Oktave unter der Trompete und eine Oktave über der Tuba –, unterscheiden sie sich in der Weite der Mensur und bestimmen damit ihren Einsatzbereich. Ist das Tenorhorn im mittleren Blech der Spezialist für die obere Tonlage, fühlt sich das Bariton in der mittleren Tonlage wohl, wobei sich das Euphonium (griechisch wohlklingend) für Soli in der unteren Tonlage besonders gut eignet. Dass die Bügelhörner des mittleren Blechs sich nicht nur für „Wumm-Ta-Ta-Stimmen“ eignen, wird jedem einleuchten, der zum Vergleich einen gemischten Chor heranzieht. Auch hier werden die Soli nicht nur von den hohen Frauenstimmen gesungen, sondern es findet ein steter Wechsel der Stimmführung durch alle Register statt, was im Zusammenspiel ein Stück erst interessant gestaltet. In einem Blasorchester kommt daher den Bügelhörner der mittleren Stimmlage die Bedeutung zu, die in einem symphonischen Orchester regelmäßig den Celli zusteht.
Die Tuba (lateinisch als Röhre übersetzt) ist der Bass im Blasorchester. Die Tuba bildet hier musikalisch das Fundament. Tiefer kommt keiner! Dementsprechend groß und schwer ist dieses Teil. Schon um der riesigen Röhre von bis zu 5,8 m Länge Töne zu entlocken, braucht ein Musiker eine gehörige Portion an Lungenvolumen. Dass Speziallisten hierauf auch schnelle Solopassagen meistern, zeugt nicht nur von deren Können, sondern erfordert auch eine erhebliche Portion an Körpereinsatz. Eben ein Instrument für ganze Kerle (von wegen „Dicke-Backe-Musik“)!
Das Horn hat seinen Namen vom Material, aus dem es ursprünglich hergestellt wurde. Bereits in den frühen Kulturen der Antike wurden Tierhörner als militärische und kultische Signalgeber verwand. Im Barock wurde versucht, die Tonhöhe durch Grifflöcher und Klappen zu verändern. Die Erfindung der Ventile Anfang des 19. Jahrhunderts löste dann den Innovationsschub aus, der die Blechblasinstrumente in den folgenden Jahrzehnten enorm nach vorne brachte. Mit der Entwicklung der Bügelhörner ist übrigens auch der Name eines belgischen Instrumentenbauers eng verknüpft, der später noch durch die Erfindung eines ganz anderen Instruments Berühmtheit erlangen sollte: Adolfe Sax.
Die Bügelhörner der mittleren bis tiefen Tonlage stellen von ihrer Entwicklungsgeschichte neben den Saxophonen die jüngsten Instrumente des Blasorchesters dar. Damit die Instrumente wegen ihrer Länge nicht auf den Schultern der vorderen Musiker lasten müssen, was diesen aufgrund des Gewichts und der Lautstärke bestimmt unangenehm wäre, wurde die Röhre mehrfach gebogen, was den Bügelhörnern die ovale Form und damit ihren Namen gab. |